Gesellschaft zur Stärkung der Verben |
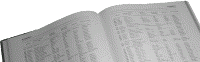
|
|
|
Sie befinden sich auf der alten Website der Gesellschaft zur Stärkung der Verben. Den Inhalt dieser Seite finden Sie jetzt in unserem Wiki. Konjugation der sinkenden Zungenspitze mit
perseverierenden Umlauten Das Paradigma hat etwas sehr Eingeschronkenes, Reliktäres. Es bezieht
sich auf eine Handvoll Verben mit langem ü. a) Bezüglich diphthongierender Formen erinnert es/sie ein wenig an die diphthongierende Konjugation der Verben mit kurzem ü, mit denen es auch das Präsens viceversum teilt. b) Im Vokalismus wird jedoch einer der scheinbaren Selbstverständlichkeiten - quasi tiefengrammatikalischen Strukturen - starker Verben des Deutschen hohngelochen: starke Verben hätten im Indikativ Präteritum und im Partizip II niemals Umlaute zu haben. Das Paradigma vereint Zwie- mit Umlauten. c) Solch grobe Verletzung der chomskyösen, tiefengrammatikalischen Erwartung kann jedoch nur unter ganz strengen Bedingungen erfolgen. Und zwar müssen beide benachbarten Konsonaten des langen ü, also x und y (Schema: x - ü - y), der „vorderen Gruppe“ angehören: also Labiale, Labiodentale, Dentale, Postdentale, Alveolare, Koronale, Laterale (dabei Plosive, Frikative wie Sona-Dingsbumse) und was es da noch für Bezeichnungen geben mag - „Grapheme“ (mit Affrikaten): b, p, sp, m, f, v, w, d, t, (z, ts), n, s, sch und l. NICHT kann das Paradigma eintreten, wenn auch nur einer der beiden benachbarten Konsonanten der „hinteren Konsonatengruppe“ angehört, also ein Guttural (auch, beim y, „ng“, sofern es solch ein „ü(h)-Verb“ gibt) oder auch ein r ist (wegen des möglichen Zäpfchen-rs, das ich gar Deutschen natürlich zubilligen muß). Auch bei der Sonderform 0 - ü - y (z.B. bei „üben“) gibt es
diese Konjugation nicht, weil der Ausgenommen sind weiters Verben, die hinter dem ü keinen Konsonanten aufweisen (z.B. blühen, verbrühen, Schema x - ü -0). Kleine Ergänzung: NICHT also, z.B., bei trüben, prüfen, bügeln, prügeln, rühmen, hüten... Das Paradigma wird sozusagen durch die Physiologie der menschlichen
Zunge erzwungen (- welchselbiges Geschehen ich lieber heranziehe, als in
stockfleckigen Bibliotheks-Grammatiken historischer Sprachstufen [Lexer,
Schützeichel, v. Murggenthal & Co] zu stöhlen & wübern). Durch
die benachbarten vorderen Konsonaten wird die Zunge, bewegungsökonomisch,
zur Bildung von Vokalen der vorderen Reihe gedrängt (finitimaler,
vicinaler, propinqualer oder accolierender Zwang; „vis vicina“, „necessitas finitima“...), - und von „o“, „u“ oder „a“ Die Teilentrundung des Vokals führt freilich auch im vorliegenden Fall zu Diphthongen (deren unsere Sprache ja reicher werden sesölle), freilich eben nicht zu (Wdh.:) „ia“, - „io“, oder „iu“ („i·e“). Nein, der Charakter des Umlautes (beim „ö“ auch die Lippenrundung) bleibt im zweiten Diphthongteil erhalten (das ist das Ungewöhnliche), nur daß die Zungenspitze beim Ablaut, der vorderen Linie des Vokaltrapezes entsprechend, absinkt. Der Konjunktiv II wird vokalisch vom P.P.P. übertragen. Das „Absinken“/Verhallen/weniger-angespannt-Werden des Vokales in Vergangenheit und Möglichkeit erinnert auch entfornen an die onomatopoetischen Konjugationen. Das Resultat der langen Rede/Schreibe liest sich dann sehr einfach:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|